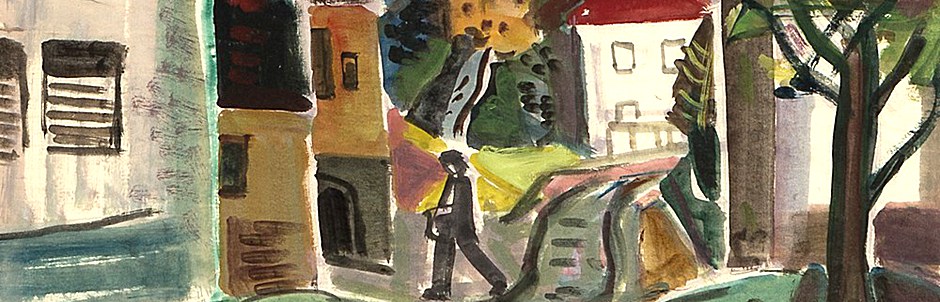
Der religiöse Rolf Müller-Landau
Vortrag von Volker Hörner anlässlich der Austellung Passion Expressiv vom 11.03.2013
1. Bild
Herzlichen Dank für die Einladung. Eine Anmerkung zu meinen Quellen. Ich beziehe mich auf das Buch - Rolf Müller-Landau. Leben und Werk -, das ich anlässlich seines 100. Geburtstages 2003 im Rahmen der Evangelischen Akademie herausgegeben habe. Alle Zitate, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind diesem Band entnommen.
Aber nun zur Aufgabe. Das Thema klingt auf den ersten Blick einfach. Sie haben mit Albrecht Müller schon über den Vater gesprochen, auch über seine Wurzeln, über dessen eigenen Vater, einen strengen Gottesmann von amusischer Härte, wie Hans Blinn schreibt. Herr Fath hat über das Werk referiert und Herr Bähr am Beispiel der Sezession die Anfänge vergegenwärtigt. Über das Werk und die künstlerische Entwicklung ist also gesprochen, die Person in ihrer Zeit in Erinnerung gerufen - auch in ihrer Rolle als Zeitgenosse und Freund. Die Schaffenskraft haben wir hier vor Augen. Das entlastet mich. Es bringt mich aber auch in Verlegenheit.
Was bleibt mir noch, zumal ich kein Kunsthistoriker bin, sondern einer, der den fast in Vergessenheit Geratenen für sich selbst entdeckt hat, der sich als Theologe dem Künstler nähert. Wie weit ist es möglich, über das Werk einen Zugang zur Innenseite des Künstlers zu finden, wenn Kunsthistoriker sagen, dass es ihm nach 1945 zunehmend mehr um die Farbe und die Komposition geht, um das Experiment mit beiden - mehr, als um die Motive und Sujets?
Wenn Sie nach religiösen Motiven im Werk Rolf Müller-Landaus gefragt hätten, dann wäre die Aufgabe vergleichsweise einfach gewesen. Ich hätte Ihnen die Arbeiten vorstellen können, in denen er biblische Motive zitiert. Aber Sie haben die Aufgabe anders formuliert: Der religiöse Rolf Müller. Ich werde also versuchen, davon zu erzählen, wie Rolf Müller zu dem wurde, was er war - von seinem inneren Weg.
Es gibt Menschen, die sprechen routiniert - auch ungefragt – über den Glauben. Rolf Müller gehört nicht zu ihnen. Er ist, wenn es um seinen Glauben geht, zurückhaltend. Nicht, weil er in sich gekehrt und wortscheu wäre. Das ist er gewiss nicht. Das belegen die Freundschaften und das offene Haus, das er mit seiner Frau Hermine vor allem in den Nachkriegsjahren pflegt. Vielleicht ist es eine, für Protestanten nicht untypische Scheu, die ihn daran hindert, sein Innerstes nach außen zu tragen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er ganz selbstverständlich in seinem Glauben lebt, weil er der Atem seiner Seele ist, so elementar wie Luft, Wasser und Licht für das Leben. Manches spricht dafür. Es gibt jedenfalls nur wenige, explizite Äußerungen von ihm. Er sieht sich wohl nicht als religiösen Virtuosen. Aber er ist in einer genuinen Weise ein religiös musikalischer Mensch, begabt mit Intuition. Er ist offen für die andere Seite der Wirklichkeit.
Natürlich liegt es nahe, sich ihm über seine Kunst zu nähern. Das werde ich auch tun. Zunächst aber mache scheinbar einen Umweg. Denn dank Albrecht Müller konnte ich auch über ein anderes Medium einen Zugang zu ihm finden. Es ist die Bibel, die Rolf Müller 1915 im Alter von zwölf Jahren von seinem Vater geschenkt bekommt - zum fleißigen Studium, wie es in der Widmung heißt. Was liegt also näher - zumal aus protestantischer Sicht -, die Spurensuche damit zu beginnen. „Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers“ - klein, handlich, auf dünnstem Dünndruckpapier, zum Gebrauch, nicht für den Schrank; ein Geschenk für den 12-Jährigen, vermutlich zum Beginn seiner Präparandenzeit. Nicht überraschend für einen Missionarssohn, aber dennoch aufschlussreich.
Die Bibel 1. Tim. 2. 4
2. – 3. Bild
Rolf Müller ist in seiner Bibel zu Hause. Was ihn anspricht, was sich mit der Zeit als sein persönliches Evangelium herauskristallisiert, das lässt sich an dem nachvollziehen, was er mit seinem Bleistift unterstreicht.
Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Die Wahrheit des christlichen Glaubens ist kein Privileg für besonders Eingeweihte oder Erleuchtete. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. An ihr können alle teilhaben. Die Wahrheit der Bibel ist – wenn Sie so wollen – demokratisch. Dass Rolf Müller gerade diesen Vers an- und unterstreicht, ist kein Hinweis auf missionarischen Eifer. Für mich ist es ein Indiz für eine große Weite des Herzens, für seine gerade nicht doktrinäre Weise, in der er als Künstler mitteilt, was uns unbedingt angeht. Von diesem Vers aus lässt sich die Brücke schlagen zu anderen Bibelstellen, die er markiert. Ich beschränke mich auf einige zentrale Stellen, um zu zeigen, woraufhin Rolf Müller seine Bibel liest.
Im Alten Testament habe ich nur eine Stelle gefunden. Auf einem Zeitungsschnipsel als Lesezeichen sind die Kapitel 40 - 44 des Propheten Jesaia notiert. Es sind einige der Gottesknechtslieder, die bewegende Zusage, dass das Leiden derer im Exil ein Ende haben wird. Sonst keine andere Passage. Auch nicht bei Hiob oder in den Psalmen. Erstaunlich. Umso intensiver beackert er das Neue Testament. Bei Matthäus: die Bergpredigt mit ihren Seligpreisungen und die Einschärfungen: ihr seid das Salz der Erde … ihr seid das Licht der Welt (Math. 5, 13.15); dann die goldene Regel: alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. (Math. 7. 12) und das Doppelgebot der Liebe. Im Markusevangelium gibt es kaum Lesespuren. Bei Lukas markiert er das Gleichnis vom reichen Kornbauern und Passagen über konsequente Nachfolge: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht (Lk. 16, 10). Es geht ihm um die Haltung gegenüber dem, was uns anvertraut ist. Das ist eine der Grundlinien, die sich aus seiner Bibellektüre herauslesen lassen.
Im Johannesevangelium unterstreicht er als Erstes: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (Joh. 1, 14); dann das nächtliche Gespräch mit Nikodemus über die Frage, wie man trotz aller prägenden Lebenserfahrung ein neuer Mensch werden kann (Joh. 3); die Ich-bin-Worte Jesu sind hervorgehoben: ich bin das Brot des Lebens (Jo. 6,35); ich bin das Licht der Welt; (Joh. 8,12); ich bin der gute Hirte (Joh. 10,11); ich bin die Auferstehung und das Leben (Joh. 11,25); ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh. 14,6), um einige zu nennen.
Aus der Fülle der Markierungen im Johannesevangelium nur noch ein Zitat: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen (Joh. 17, 3). Das Johannesevangelium liest er besonders intensiv. Die leibhaftige Präsenz Gottes in der Gegenwart, ewiges Leben im Augenblick der Begegnung mit Jesus und in der Nachfolge – das ist es, was ihn nicht loslässt: Innere Gewissheit und nach außen dafür einstehen. Das sind, wie in einer Ellipse, die beiden Brennpunkte, um die Rolf Müller kreist.
Auch in den Briefen des Neuen Testaments bis hin zur Offenbarung des Johannes lässt sich diese Spur verfolgen. Seine Gewissheit nährt sich aus der Bibel. Ganz unterstrichen und umrandet Hebr. 11,1: Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wie viel und was alles mag für ihn in diesem Satz aufgehoben gewesen sein? Seine frühe Krankheit, seine konstitutionelle Schwäche, das Leiden an der Zeit und ihren Einengungen? Im 1. Johannesbrief mit seinen beschwörenden Bitten nicht aus der Liebe zu fallen, findet er den Glutkern seines Evangeliums: Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm (1. Joh. 4, 16). Darin wurzelt sein Glaube. Von hier aus versucht er, in der Wahrheit zu leben.
Am Ende dieses kurzen Durchgangs durch Rolf Müllers Bibel noch ein Vers aus der Offenbarung. Nicht nur mit dem Bleistift, den er sonst benutzt, sondern mit einem dicken Kugelschreiberstrich - so dass es ins Auge springt - markiert er: Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach (Offb. 14, 13). Kann man das nicht als ein Vermächtnis lesen? Der Künstler, der von seiner Arbeit ruhen wird, bleibt mit und in seinen Arbeiten über den Tod hinaus präsent?
Ein Brief
3. Bild
Ich will Ihnen auch von einem Brief berichten, den Rolf Müller an Johannes Bähr schreibt. Sie sind seit ihrer Jugend befreundet. Der Brief ist nicht datiert. Aber er muss nach 1933, vielleicht auch Anfang oder Mitte 1934 geschrieben worden sein. Das lässt sich aus den Andeutungen schließen. Sorge um den Freund spricht aus den sechs Seiten. Geradezu beschwörend redet er auf ihn ein.
Mein Lieber,
ich muss Dir schreiben, es läßt mir keine Ruhe. Du hast sicherlich heute abend auch Goebbels gehört. Wenn nicht, so kannst du es ja auch lesen, Hans, es geht mir schon so lange nach, Du verrennst dich. Ich kenne Dich von Jugend auf u. wir sind Freunde und nichts war zwischen uns all die Jahre. Du weißt, dass ich treu zu dir stehe. Du weißt, dass ich mit Dir für unseren Herrn Jesus Christus, der uns das Leben ist, lebe und sterbe.
Aber ich muss Dich warnen, warnen aus treuem Freundesherzen, Hans, Lieber, vergiß über allem Streit und Kampf, in den du hineingezogen wirst, eines nicht: Gott unser treuer Herr, ist so groß, ... Will, dass wir ihm mit Freunden in vollem Glauben dienen. ….. Hans, …. Ihr Pfarrer habt den allerschwersten Beruf, den es heute gibt. Wer von Euch nicht ganz in voller Demut zu seinem Herrn und Heiland steht als sein Werkzeug, …, der verleugnet seinen Herrn gleich in welchem Lager er steht: DC oder BK. Demut, nur diese eine große Gabe von Gott ist, was unsere Kirche noch retten kann… Versuch es einmal alles beiseite zu lassen: Politik, Kirchenkampf, persönliche Gunst und Feindschaft in Deinem Dorf und sei ein freudiger Zeuge Gottes. … Hans, es sind Dir durch Gottes Gnade viele Gaben gegeben, werde nicht kleingläubig! Sei ein froher, freier Mensch, u. diene Deinem Gott und der Dir anvertrauten Gemeinde. … Mein Lieber, ich schreib´ Dir um Mitternacht, ich musste aufstehen, weil es mich dazu treibt. Laß Dich nicht bedrücken, sei mutig, freudig, sei ein Mann, versinke nicht in Untergangsstimmung. Gott lebt, Christus lebt und mit ihm, Du und ich und ein Häuflein, vielleicht größer als es in unsere Untergangsstimmung passt – und des wollen wir uns freuen.
Ein geradezu flehendlicher Brief. Er klingt wie ein Nachhall des weihnachtlichen Fürchtet euch nicht! Nicht weil es keine Gründe zum Fürchten gibt. Die gibt es. Fürchtet euch nicht, weil Gott das letzte Wort hat - und dieses letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Es sind Nachtgedanken, die Rolf Müller umtreiben. Die Intensität, mit der er seinen Freund beschwört, lässt ahnen, was auch für ihn auf dem Spiel steht. Es ist die Angst, dass die nationalsozialistische Maschinerie das Fühlen und Denken auch derer überrollen könnte, die sich nicht blenden lassen.
Nur wenige Anmerkungen zum Hintergrund. Der Adressat, Johannes Bähr, ist kein ängstlicher Zeitgenosse. Er gehört 1934 zu den Gründungsmitgliedern der Pfälzischen Pfarrbruderschaft, die der Bekennenden Kirche nahe steht. 1937 muss auf Druck der Bergzabener NSDAP-Kreisleitung seine Gemeinde in Heuchelheim verlassen. Der Grund: er weigert sich, die noch verbliebenen fünf Juden - nach Angaben des Landeskirchenrates handelte es sich bei den betroffenen Mitgliedern des protestantischen Pflegevereins um alleinstehende, pflegebedürftige Personen, die seit Gründung dem Diakonissenverein angehören -, Johannes Bähr weigert sich, sie auszuschließen und nicht mehr zu versorgen. Die Kirchenregierung versetzt ihn nach Mutterstadt. Auch dort tut er, was ihm Glaube und Anstand gebieten. Nach der Zerstörung der Synagoge in der Progromnacht sagt er im Religionsunterricht am Morgen danach: Was hier gemacht wird, ist nicht recht - Juden sind auch Menschen und mit Menschen muß man immer menschlich umgehen. Einige Tage Haft sind die Folge. Das muss man mit bedenken, wenn man den Brief verstehen will.
Rolf Müller treibt um, was sich seit 1933 abzeichnet. Aber er ist kein Kämpfer. Der offene Widerstand ist nicht seine Sache, er ist kein politischer Mensch, würde man heute sagen. Aber er ahnt und sieht, was der Faschismus aus Menschen macht, wie sie ihre innere Freiheit verlieren und verkommen. Er sieht es mit wachem Gewissen und klarem Blick. Wenn man den schon zitierten Vers des Hebräerbriefs etwas abwandelt, könnte man sagen, für ihn geht es ums Ganze, um den Glauben als einer unverbrüchlichen Zuversicht, dessen, was man hofft und ein Nichtverzweifeln angesichts dessen, was geschieht. Und diese unzerbrüchliche Gewissheit, die sieht er bei seinem Freund in dessen Sorge um den Weg der Kirche bedroht. Er will den Freund, mit dem ihn eine tiefe Herzensfrömmigkeit verbindet, nicht verlieren.
Er kennt Bonhoeffer vermutlich nicht. Aber was Bonhoeffer zum Jahreswechsel 1944/45 dichtet: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag - in dieses Vertrauen rettet er sich, als er in Landau und gegen Kriegsende in der kleinen Welt von Heuchelheim überwintert. Diese Jahre waren für ihn äußerlich wie eine Brachzeit, in Innern eine Zeit der Auseinandersetzung und des Reifens. Was er in seiner Kunst nach 1945 in einem eruptivem Schaffensdrang ins Bild setzt, wächst in diesen Jahren latent in ihm heran.
Seine Kunst
Die Kathedrale von Metz
4. Bild
Bin ich zu weit gegangen mit meinen Deutungen? Ich habe das Bild eines Menschen gezeichnet mit einem unverbrüchlichen Vertrauen, das Bild eines Protestanten, der seine Bibel kennt und mit ihren Geschichten lebt. Dies ist gewiss eine ganz wesentliche Seite von Rolf Müller: ein Urvertrauen von Kind auf. Nicht selbstverständlich, wenn man das zeitlebens schwierige Verhältnis zu dem Vater mit bedenkt. Oder auch seine Erkrankungen. 1920 muss er im Alter von 17 Jahren wegen einer Epilepsie in die Korker Anstalten nach Kehl gehen. Frühe Prüfungen und Erschütterungen. In dieser anderen Umgebung trifft er auf Wohlwollen. Er findet Förderer. Sie ermutigen ihn zu seinem Weg. Zeichnen und Malen heilen. Der Anstaltsarzt erkennt seine Begabung und wird sein Fürsprecher gegenüber den Eltern. In seiner Bibel ist im 2. Kor.- Brief auch der Vers unterstrichen und zusätzlich mit einem Balken an der Seite markiert - also ihm besonders wichtig: lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist die Antwort, die Paulus auf seine Bitte erhält, Gott möge ihn von seiner Epilepsie befreien, damit er noch intensiver für die Sache des Glaubens wirken könne. Ob er sich darin wiedergefunden hat?
Der junge Rolf Müller geht seinen Weg. Malen wird für ihn zur Sprache. Die Jahre 1933/45 sind Jahre der Krise. Nach meinem Eindruck lassen einige Bilder aus Lothringen erahnen - besonders der Zyklus von der Kathedrale von Metz, die er 1940 in mehreren Versionen malt -, zu welchen neuen Ausdrucksformen er jenseits der Krise nach 1945 aufbrechen wird. Ein Kunsthistoriker sieht in der Kathedrale für den Maler eine Art Rettungsanker für seine aufgewühlte Gemütsverfassung. Die Kathedrale im Gewitter, die Kathedrale im Schnee – Schwefelgelb, kaltes Blau, stumpfes Braun, die Fenster scheinen tot. Das Abbild der himmlischen Stadt scheint kein Ort der Zuflucht mehr zu sein. Oder sind die Bilder vielleicht doch Zeichen für eine stumme Klage, vielleicht sogar für die gewagte Hoffnung - ex contrario -, ein Nichtverzweifeln, an dem, was man sieht? Dieser Zyklus deutet für mich das Ausmaß der Krise an, die Rolf Müller durchleidet. In einem Brief schreibt er am 26.10.1944: Apokalyptische Gesichte umgeben mich und ich möchte klagen wie ein alter Prophet und den Menschen sagen, dass sie wieder Menschen seien. Aber es ist vergebens, die Geisel Gottes wird uns zerschlagen. In Bildern möchte ich es sagen, aber ich kann es nicht realisieren. Seine Krise muss noch abgründiger gewesen sein, als es die Bilder erahnen lassen.
Es ist schwer vorstellbar, dass die Abgründe, die sich vor ihm auftun, nicht auch seinen Glauben berühren. Wir wissen kaum etwas davon. Wir können nur aus den späteren Arbeiten darauf schließen. Ich glaube, er geht in dieser Zeit einen weiten Weg von einem ersten, fast kindlich naiven Vertrauen hin in eine zweite Naivität (Paul Ricoeur); eine zweite Naivität, die dem Leben abgerungen ist, die den Zweifel kennt, und in das Vertrauen um seine Verletzlichkeit weiß. Der erwachsene Glaube strotzt nicht vor ahnungsloser Gewissheit; er ist ein versehrter Glaube, der aber dennoch auf die bewahrende Güte hofft, die Gott selbst ist.
Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die Jahre des inneren Exils sind für Rolf Müller keine Zeit des Stillstands, sondern eine Zeit großer Anspannung. In ihr wandeln sich seine Frömmigkeit und seine Religiosität. Die spätere Kunst sehe ich als beredte Symbole einer prophetischen Klage, und als Mahnruf. Mit den neuen Ausdrucksformen formt sich auch eine neue, bis dahin nicht sichtbar gewordene Seite seiner Frömmigkeit. Er knüpft an die biblischen Motive und Geschichten an, die tröstenden und ermahnenden Erzählungen, die ihm seit Kindeszeiten vertraut sind. Er greift sie auf und stellt sie - mit dem geschärften Blick für die Zeit - in einen neuen Zusammenhang. Ein Jahrzehnt nach den Kathedralenbildern malt er 1950 das apokalyptische Triptychon und den apokalyptischen Engel.
Apokalyptisches Triptychon
5. – 7. Bild
Dunkle Farben. Braun-, Rottöne im Linken, dunkles Rot und Violett im Mittleren, Blau- und Grüntöne im rechten Bild. Dreiecke und Kreissegmente fügen sich zu prägnanten Formen. Die angedeuteten Figuren sind Kompositionen. Sie wachsen aus einzelnen Elementen zu einem Ganzen.
Im linken Bild: In der Mitte der Engel mit der Posaune, er trägt ein janusartiges Doppelgesicht. Er sieht, wie der Mythos erzählt, in die Zukunft und in die Vergangenheit. Der Gekreuzigte mit der Dornenkrone, mit der durchbohrten Hand ist seine Rückseite. Das Antlitz ist abgeschattet. Auf dem Leib liegt die Leier des Orpheus. Er ist umsonst in die Unterwelt gegangen. Eine Analogie zu Christus, der umsonst gestorben sein könnte? Die andere Seite des Gesichts ist hell. Es zeigt den Engel der Posaune. Er blickt in die Gegenrichtung. Aber was kündigt er an? Es könnte der Engel sein, der die Gnade des Aufschubs und das Geschenk einer zweiten Frist verkündet.
In der Mitte: Geschichtete Figuren. Im Hintergrund ein Gesicht, ein Schädel mit dunklen Augenhöhlen. Davor in fahler Farbe ein großes J. Es könnte eine halb liegende oder eine Gestalt sein, die gegen das Niedersinken ankämpft. Ein J für Jesus? Am unteren Rand gebrochene Linien. Sie setzen sich im rechten Bild fort, Dort fließen sie ein in die Umrisse eines Drachen in den Konturen einer Ruinenlandschaft. In der Tradition zeigt das dreiflügelige Altarbild in der Mitte oft die Kreuzigung. Hier sehe ich eine Szene zwischen Grablegung und Auferweckung. Eine Gestalt im Zwischenraum, zwischen Niedersinken und dem Versuch, Halt zu finden.
Im rechten Bild: eine Gestalt mit Lanze, ein Halbgesicht, das auf den Drachen blickt. Es ist eine Anspielung auf den Erzengel Michael, den Drachentöter, von dem die Apokalypse erzählt, dass er die Frau und das Kind rettet. Der Drache, das Tier aus der Unterwelt, Symbol für ungebändigte Kräfte des Unbewussten. Der Engel scheint ihnen überlegen. Er setzt zum Todesstoss an. Bei aller Eindeutigkeit ist es aber keine triumphale Szene. Die Geschichte, die das Triptychon erzählt, ist nicht zu Ende. Anfang und Ende sind nicht festgelegt. Sie kann in beide Richtungen gelesen werden. Vielleicht ist dies die stecknadelkopfgroße Hoffnung, die R. Müller-Landau in dieser Arbeit aufscheinen lassen möchte. Das Beängstigende bleibt. Die Antwort bleibt offen.
Der im gleichen Jahr wie Rolf Müller 1903 geborene Philosoph Th. W. Adorno sagt 1950 im Darmstädter Gespräch über das Menschenbild in unserer Zeit: Die Harmonie des modernen Kunstwerkes … besteht (sc. darin), dass es das Zerrissene, selbst unversöhnt, unversetzt zum Ausdruck bringt und ihm standhält, und dass eigentlich in diesem Standhalten, in diesem Wortefinden für das, was sonst wortlos ist, das einzig Versöhnende liegt … Und ein Jahr später schreibt er 1951 am Ende seiner Minima Moralia (Nr. 153, S. 133f): Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung sich darstellten. darauf allein kommt es dem Denken an.
Und dem Glauben, ist wohl im Sinne Rolf Müller hinzuzufügen. Er widerspricht mit seiner Kunst vehement dem von anderen beklagten Verlust der Mitte. Sie suchen nach der Blutgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder Unterschlupf in einer vermeintlich ewig gültigen Ordnung. Sie wollen sich nicht vortasten in eine zweite, geläuterte und hellsichtige Naivität. Sie wollen in einem Salto mortale zurück in das ewige Bild des Menschen (Glaser S. 16). Aber was sollte das sein angesichts des gerade Geschehenen? Für Rolf Müller gibt es kein solches Zurück. Gewiss, es geht es ihm nach 1945 auch darum, wieder Anschluss zu finden an die künstlerischen Entwicklungen vor allem in Frankreich. Er übt sich in der kurzen Zeitspanne, die ihm gewährt ist, in vielen Spielarten und Stilen. Aber es geht ihm nicht nur um das Experiment im Formalen. Dessen bin ich mir sicher. Er kann nach allem, was war, nicht wieder zur Tagesordnung übergehen und malen, als wäre Gott nicht mit den Opfern des Holocaust in den Tod gegangen, als hätte es Hiroshima und Nagasaki nicht gegeben.
Rolf Müller entspricht die Sicht Adornos. In seinem Triptychon setzt er dessen Intention souverän ins Bild. Er malt sich das Entsetzen von der Seele - nicht nur im Rückblick, auch angesichts der Gegenwart. Es ist der Kalte Krieg der 50er Jahre. Bert Brecht fordert in dieser Zeit von der Literatur eingreifendes Denken. Könnte man in Analogie dazu nicht auch von einem eingreifenden Malen sprechen? Rolf Müller ist zu einem zweifelnd Hoffenden, zu einem mahnend Fragenden geworden. Für ihn gibt es kein frommes Reservat, in das man sich flüchten könnte. Das ist die gereifte, prophetische Seite seiner Religiosität.
Die gotische Kapelle in Speyer
Wie kenntnisreich und durchdacht Rolf Müller antike Mythen aufgreift, möchte ich Ihnen an der gotischen Kapelle auf dem alten Friedhof - dem heutigen Adenauerpark - in Speyer zeigen. Er gestaltet die Fenster im Chorraum. Es ist eine spannende Aufgabe. Die Kapelle stammt aus dem Jahr 1555 und war die erste Kirche der Lutheraner in Speyer. Sie soll nun zu einem Kulturraum für kammermusikalische Konzerte werden. Der Sakralraum und seine Aura sind mit dem neuen Zweck in eine Zwiesprache zu bringen. Und dies sollen vor allen die neuen Fenster leisten. In seinem Entwurf verbindet Rolf Müller kongenial den antiken Orpheusmythos mit dem Christusthema. Es ist exemplarischer Dialog zwischen antiker und christlicher Weltdeutung.
Vermutlich kennen Sie die Sage: Orpheus trauert um Eurydike, seine verstorbene Frau. Er sucht nach ihr, steigt hinab zu den Toten. Er bezaubert mit seinem Gesang Hades, den Gott der Unterwelt und bewegt ihn, ihm die Geliebte wieder zurückzugeben. Auf dem Weg zurück ans Licht darf Orpheus nur nach vorne blicken. Nur unter dieser Bedingung dürfen sie gehen. Als er hinter sich Eurydikes Schritte nicht mehr hört, dreht er sich um. Eurydike fällt zurück; er verliert sie für immer. Seit dem 2. Jahrhundert deuten Christen diesen Abstieg in die Unterwelt als Hinweis auf Christus. Auch er ist nach ihrem Bekenntnis Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Mit dem entscheidenden Unterschied: Orpheus muss Eurydike bei den Toten zurück lassen; Christus dagegen nimmt die Toten in seiner Auferstehung mit hinein in das Ewige Leben. So mischen sich klassische Orpheusmotive mit Erzählungen von Jesus. Auf diese Wirkungsgeschichte nimmt Rolf Müller in der gotischen Kapelle Bezug.
Die Fenster der gotischen Kapelle
8. – 12. Bild
Die Komposition ist klar. Sie lässt sich von der linken wie von der rechten Seite auf die zentrale Mitte hin lesen. Die Farbgebung unterstreicht diese beiden Blickrichtungen. Links dominieren dunkle, eher Distanz schaffende violette, Grün- und Grautöne, Nachtfarben; halblinks werden sie unterbrochen von einem fast kalten Weiß und einer schwefelgelben Leuchtspur (RM); rechts sind es grüne, gelbe, blaue und violette Töne, im zweiten Fenster von rechts unterbrochen von leuchtendem Rubinrot. Der Blick gerht zum zentralen Bild in der Mitte. Die beiden Fenster rechts und links außen und die beiden halbrechts und halblinks korrespondieren mit einander. Dem trauernden Orpheus stehen im rechten Bild zwei Gestalten mit Laute und Flöte gegenüber. Tod und Trauer auf der einen, das Lob des Lebens auf der anderen Seite.
Halblinks ist das Motiv des Schnitters zu sehen, ein Symbol des Todes. Die Antike kennt es, auch in der Bibel ist zu finden. Hier erscheint der Tod als apokalyptischer Engel. Halbrechts steht dem Künder des Todes der Verkünder des Lebens gegenüber. Fürchtet euch nicht, ist die Botschaft des Engels. Goldton auf seinem Gesicht und die segnend erhobenen Hände zeigen: es ist eine Geschichte aus einer anderen Welt. Zwischen dem Künder des Todes auf der einen und dem Verkünder des Lebens auf der anderen Seite hindurch geht der Blick weiter zum Herz der Komposition, zu einem österlichen Bild. Es ist der Fluchtpunkt, auf den die beiden Erzählstränge zur Rechten und Linken hinführen. Die dunklen Farben weichen von unten nach oben. Das Rotviolett an den Seiten unterstreicht die Wirkung. Es ist eine Lichtgestalt von großer Klarheit und Transparenz. Unter ihren Füßen am Boden wieder die Schlange. Von dort aus strebt die Gestalt nach oben, scheinbar fortwährend, sie wächst, bis sie fast das ganze Fenster füllt.
Vieles, was wir in den Fenstern sehen, kennen wir aus der Tradition. Auch die Farbsymbolik ist vertraut. Neu ist, wie Rolf Müller sie verarbeitet und in diesem Raum ordnet. Stringent führt er zu seiner Botschaft. Von der Christusgestalt geht eine große Ruhe aus. Es ist nicht der Gekreuzigte, der zum Opfer geworden ist, sondern das Symbol dessen, der durch den Tod gegangen ist. In ihm leben, weben und sind wir. … Wir sind seines Geschlechts (Acta 17, 28 - in seiner Bibel ist dieser Vers doppelt unterstrichen und am Rand in griechischer Sprache zitiert). Der Christus, das Bild des Menschen und das Bild Gottes, hält im Zeichen des Kreuzes den Kosmos, den neuen Himmel und die neue Erde, und erhält ihn im Licht seines Lebens. Das ist sein Bekenntnis.
Die Aquarelle
Zwei Jahre vor seinem Tod machen sich Rolf Müller und seine Frau Hermine 1954 auf zu einer Reise in die Provence. Sie fahren nicht unbeschwert. Seine Krankheit macht ihn zu schaffen. Aber sie hindert ihn nicht, die Weite dieses Farbenmeers und die Musikalität der Landschaft in sich aufzunehmen. Es entstehen Aquarelle, die von Licht und Wärme durchflutet sind, Bilder von einer seltenen Intensität und Leuchtkraft.
Olivenbäume in der Provence
Provence und Alpes Maritimes
Der Teppich der Provence
15. – 17. Bild
In manchen von ihnen löst er sich ganz von der gegenständlichen Form, ordnet die Farben in ornamentalen Mustern, wie beim Teppich der Provence. Er entgrenzt, ohne dass die Farben ins Formlose zerfließen. Er abstrahiert, weil nichts Figuratives, keine konkrete Form das alles durchscheinende Licht stören soll. Er malt, als sei er vorweggenommen in ein Haus aus Licht, um es mit einem Vers von Marie – Luise Kaschnitz zu sagen.
Was er in sich aufnimmt, bringt er mit zurück. Er kann sicher nicht mehr alles zu Papier bringen, was in ihm zum Bild werden will. Ein Jahr später – 1955 – ist seine Diabeteserkrankung fortgeschritten. Ihm wird ein Bein amputiert. An seine Eltern schreibt er: … Das Bein fehlt, es bedeutet nicht mehr als eine äußere Behinderung. Gott hat den Geist klar erhalten und er muss die Materie beherrschen. Ist es nicht köstlich zu wissen, dass der Geist auch ein brüchiges Gefäß zur Wohnung nehmen kann? So will ich fröhlich und getrost meine Straße ziehen, eingedenk des immer jungen Paul-Gerhard-Liedes: ´Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann´, auch wenn es nur noch ein einziger ist. Mag sein, dass er die Eltern damit beruhigen will. Für mich zeigen diese Worte aber auch ganz unverstellt, wie er das Schwere leicht und das Leben als Geschenk anzunehmen vermag.
Ich habe Ihnen Rolf Müller vorgestellt als bibelkundigen Protestanten, als aufrichtigen Freund, als Menschen, der seines Glaubens gewiss ist, der in der Mitte seines Lebens unter den Belastungen böser Jahre aus sich und über sich hinauswächst, der Angst und Zweifel kennt und der beides in seiner Kunst in prophetische Mahnungen übersetzt, der gegen Ende noch einmal aufbricht ins farbentrunkene, lichtvolle Helle, das Symbol für die Liebe, die Gott ist.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich habe dieses Bekenntnis Bonhoeffers vom Jahreswechsel 1944/45 schon einmal auf Rolf Müller bezogen. Ich bin mir fast sicher, dass diese Worte die seinen geblieben sind: Gottes Güte ist alle Morgen neu. Der geerdete Mensch, der er ist, in sich ruhend und doch mit rastloser Schaffenskraft und Schaffensfreude, ein wacher Zeitgenosse und umgetrieben von den Entwicklungen der Nachkriegszeit - Rolf Müller kommt am 2. Dezember 1956, dem 1. Advent des Jahres auf seinem inneren und äußeren Weg ans Ziel, an die Schwelle zur anderen Seite der Wirklichkeit. Über seiner Todesanzeige steht die Losung des Tages: Haltet mich nicht auf! Denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Das Wort für diesen Tag, an dem sich Ende und Anfang berühren und der Lebenskreis sich schließt, das Wort – es entspricht ihm.

